
Mit grünen Gasen in die klimaneutrale Zukunft.
Bis 2030 will Deutschland seine Treibhausgasemissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Damit das gelingt, müssen Industrie, Verkehr und das Energiesystem neu gedacht werden. Eine zentrale Rolle dabei spielt grünes Gas. Wir stellen wichtige Ansätze dazu vor.
Die Energiewende konfrontiert Industrie, Forschung, Politik und Gesellschaft mit enormen Herausforderungen. Robert Schlögl, geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion, sagt sogar: "Die Energiewende ist der komplette Umbau der Energieversorgung und damit die größte Wirtschaftsumstellung des 21. Jahrhunderts."
Denn mit dem Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft allein ist es nicht getan. Zwar hat Ökostrom schon heute einen Anteil von 45,4 Prozent am Bruttostromverbrauch der Bundesrepublik. Doch die Sektoren Wärme und Verkehr hinken mit 15,2 Prozent beziehungsweise 7,3 Prozent weit hinterher. Auch der weitere Ausbau der regenerativen Energien wird nicht reichen, um den gewaltigen Energiebedarf der Zukunft zu decken.
Deshalb braucht es neue Technologien, damit wir in Zukunft CO2-neutral leben, heizen und fahren können. Grünes Gas spielt dabei eine wichtige Rolle.
Was ist grünes Gas?
Als grünes Gas werden alle gasförmigen Energieträger bezeichnet, bei deren Verbrennung nicht mehr CO2 freigesetzt wird, als zuvor der Atmosphäre entnommen wurde. So heißt es in einer Definition des BDEW Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Zu den grünen Gasen zählen:
- Biogas: Biogas entsteht bei der Vergärung von Biomasse und kann veredelt ins Gasnetz eingespeist werden.
- Wasserstoff: Wasserstoff entsteht entweder durch die Elektrolyse von Wasser mittels Strom (Power-to-Gas) oder dadurch, dass Erdgas unter großer Hitze in Wasserstoff (H2) und CO2 aufgespalten wird. Das Kohlendioxid wird dabei zur weiteren Verwertung aufgefangen.
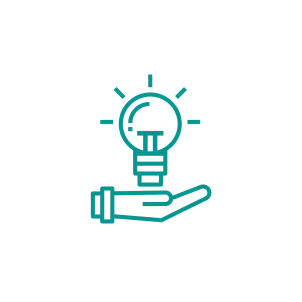
Biogas, Ökogas, Naturgas, Klimagas – was ist was?
Biogas wird aus Biomasse wie zum Beispiel Bioabfällen, Pflanzen, Holz oder Gülle gewonnen. In veredelter Form ist es zum Beispiel im GASAG | Naturgas enthalten. Ergänzt wir es dort um Wasserstoff und Ökogas.
Wie wird grünes Gas produziert?
Wir erklären, wie und wo grüne Gase - wie Biogas oder Wasserstoff - produziert werden:
Biogas
Überall, wo es gärt, entsteht Biogas, genauer gesagt Methan (CH4). Zum Beispiel in Mooren oder Güllegruben. Biogasanlagen funktionieren im Grunde nach demselben Prinzip. Nur dass hier Mikroorganismen die Gärung künstlich anstoßen. Dieser Prozess heißt Methanogenese. Dabei entsteht durch die Reaktion von Wasserstoff mit Kohlenstoffdioxid Methan. Das wird anschließend zu Biomethan, synthetischem Erdgas (CH4) veredelt und kann ins Gasnetz eingespeist werden. In 90 Prozent der Fälle wird das Biogas direkt am Entstehungsort in Blockheizkraftwerken in Strom und Wärme umgewandelt.
Biomethan kann aber beispielsweise auch verwendet werden, um Fahrzeuge mit Brennstoffzelle anzutreiben oder mit Brennstoffzellen-Heizungen Wärme zu erzeugen.
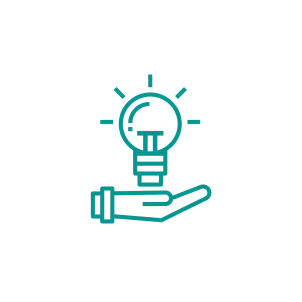
Biogas aus Berlin
In der modernen Biogasanlage der Berliner Stadtreinigung (BSR) in Ruhleben werden jedes Jahr 70.000 Tonnen Bioabfall zu Biogas umgewandelt. Damit werden 160 Müllfahrzeuge angetrieben, die 60 Prozent des Berliner Rest- und Biomülls abholen. Das sorgt für eine rußfreie Stadt und spart nebenbei pro Jahr rund 2,5 Millionen Liter Diesel.
Grauer und grüner Wasserstoff
Wasserstoff ist gerade in Politik und Forschung stark im Trend. Manche sehen ihn als „Erdöl der Zukunft“ an. Dabei ist Wasserstoff eigentlich ein alter Bekannter und noch dazu das häufigste Element im Universum. Allerdings: Ohne Veredelung ist Wasserstoff nicht nutzbar. Und das war bisher der Haken.
Beim herkömmlichen Verfahren zur Wasserstoffproduktion, der Dampfreformierung, wird Erdgas unter großer Hitze in Wasserstoff und CO2 aufgespalten. Pro hergestellter Tonne dieses sogenannten grauen Wasserstoffs fallen 10 Tonnen CO2 an. Dieses Kohlendioxid wird nicht gespeichert oder weiterverwendet, sondern entweicht ungenutzt in die Atmosphäre.
Die Folge: eine katastrophale CO2-Bilanz. Mit diesem „schmutzigen“ grauen Wasserstoff hat die aktuelle Debatte allerdings nichts mehr zu tun. Im Gegenteil: Im grünen Wasserstoff liegt die Zukunft.
Grüner Wasserstoff aus Power-to-Gas – sauberer geht’s nicht
Grüner Wasserstoff wird ausschließlich aus erneuerbaren Energien hergestellt. Power-to-Gas (PtG) heißt das Prinzip, bei dem Strom aus regenerativen Energiequellen wie Wind oder Sonne durch Elektrolyse in sauberen Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt wird.
Dieser grüne Wasserstoff kann zu einem kleinen Teil entweder direkt ins Gasnetz eingespeist werden. Oder er wird durch Zugabe von CO2 – etwa aus der Luft oder als Restprodukt aus Biogasanlagen – zu synthetischem Erdgas (CH4) veredelt. Ein weiteres Einsatzgebiet mit enormem Potenzial: Wasserstoff-Autos.
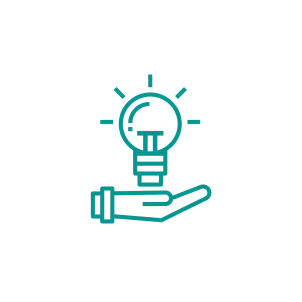
Woher kommt der Strom, wenn die Sonne nicht scheint oder kein Wind weht?
Ganz nebenbei löst das Power-to-Gas-Verfahren noch ein weiteres Problem der Erneuerbaren, nämlich die Frage: Woher kommt eigentlich der Strom, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind nicht weht? Die Lösung lautet: Man speichert ihn einfach.
Bislang war das noch nicht im großen Stil möglich, ganz im Gegenteil: Bei Überkapazitäten im Stromnetz mussten Windkraftanlagen abgeriegelt werden. Mit Power-to-Gas werden diese Überkapazitäten einfach für die Wasserstoffproduktion genutzt. Der Wasserstoff landet dann in unterirdischen Energiespeichern – bis wir die Energie wieder brauchen.
Mit blauem und türkisem Wasserstoff die Klimaziele erreichen?
Nicht zu 100 Prozent grün, aber trotzdem CO2-kompensierend ist der Ansatz, fossiles Erdgas zu dekarbonisieren, also das CO2 abzuscheiden. Unter großer Hitze wird aus Erdgas Wasserstoff erzeugt und Kohlendioxid abgeschieden.
Je nachdem, was danach mit dem überflüssigen CO2 passiert, unterscheidet man zwischen blauem und türkisem Wasserstoff. Beide Verfahren gelten als mögliche Brückentechnologien, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen.
Blauer Wasserstoff
Wird das CO2, das bei der Herstellung entsteht, im Untergrund eingelagert, spricht man von blauem Wasserstoff. Dieser Prozess heißt Carbon Capture Storage (CCS). Das geologische Speicherpotenzial Europas ist immens, Schätzungen der International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) zufolge liegt es bei 134 Gigatonnen. Trotzdem ist die Speicherung von CO2 im Untergrund, beispielsweise unter dem Meeresboden, umstritten. Die Forschung hat noch keine abschließende Antwort auf die Frage gefunden, wie sicher dieses Verfahrens ist (zum Beispiel was Erdbebensicherheit und langfristige Lagerung angeht). Aktuelle Studien laufen noch.
Türkiser Wasserstoff
Wird das Kohlendioxid, das bei der Abscheidung entsteht, nicht eingelagert, sondern zur stofflichen Nutzung weiter veredelt (Carbon Capture and Utilization, CCU), spricht man von türkisem Wasserstoff. Fester Kohlenstoff spielt etwa in der chemischen Industrie, aber auch bei der Produktion von Baumaterialien eine Rolle.
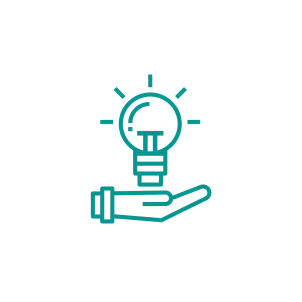
Die Gasinfrastruktur für die Gestaltung der Zukunft nutzen
Im Transformationsprozess spielt klassisches Erdgas als Brückentechnologie eine wichtige Rolle und garantiert Versorgungssicherheit. Die Infrastruktur des Gasnetzes gehört zu den besten in Europa.
536.000 Kilometer lang sind seine Leitungen. Hinzu kommen unterirdische Gasspeicher. Die gewachsene Gasinfrastruktur ist ein Rückgrat der Energiewende. Die Gasleitungen sollen zu Lebensadern einer dekarbonisierten, also CO2-freien, Energiezukunft werden. Künftig wird auch grünes Gas durch die Leitungen fließen.
Biogas oder Wasserstoff – was ist besser?
Sowohl Biogas als auch grüner Wasserstoff sind nachhaltige Alternativen zu Erdgas. Die Frage, welches grüne Gas besser ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Neben den genannten Vorteilen haben beide auch Nachteile.
- Biogas zum Beispiel bindet Anbaufläche für Nutzpflanzen wie Mais, die ausschließlich zur Biogaserzeugung angebaut werden.
- Außerdem können die Gärprozesse in den Biogasanlagen zu einer Geruchsbelästigung für Anwohner führen.
- Die Gewinnung von grünem Wasserstoff hingegen steht noch am Anfang. Es sind hohe Investitionen nötig, um die Mengen an Wasserstoff zu produzieren, die es braucht, um den Bedarf der Gesamtbevölkerung zu decken. Das führt dazu, das Wasserstoff gerade noch verhältnismäßig teuer ist.
Insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt funktionieren die grünen Gase am besten in Kombination. Werden sie zusammen verwendet, lassen sich die noch vorhandenen Schwächen ausgleichen. Deshalb enthält unser GASAG | Naturgas sowohl Biogas als auch Wasserstoff.
Grünes Gas für das Energiesystem der Zukunft
Um in Zukunft wirklich alle fossilen Brennstoffe ersetzen zu können, müssen erneuerbare Energien nicht nur für den Stromsektor, sondern auch für Wärme und Verkehr als echte Alternative zur Verfügung stehen. Erst wenn erneuerbare Energien sektorenübergreifend einsatzbereit sind, wird die Energiewende gelingen. Grünes Gas wird in diesem System eine zentrale Rolle spielen. Und deshalb arbeiten die Gasversorgungsunternehmen mit Hochdruck daran, neue Konzepte umzusetzen. Denn jetzt kommt es darauf an, verfügbare Technologien so auszubauen und zu entwickeln, dass sie wirtschaftlich sind und für Kunden bezahlbar werden. Wenn wir die größte Wirtschaftsumstellung des 21. Jahrhunderts bis 2045 meistern wollen, müssen wir Gas geben.